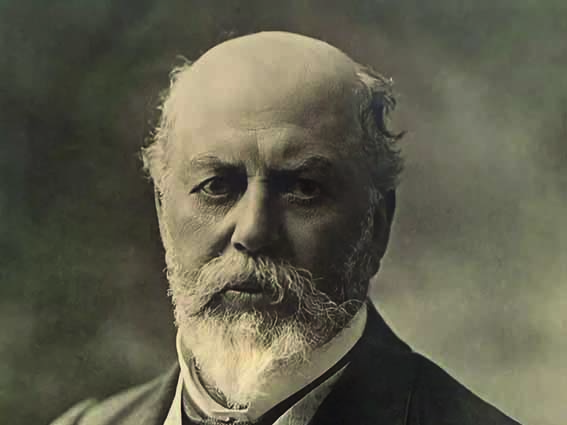Fischsterben in der Etsch

Bonus für Elektrohaushaltsgeräte
6. Oktober 2025
Von Kapelle zu Kapelle im Pfelderer Tal
6. Oktober 2025In der einst artenreichen Fauna der Etsch lebten über 30 einheimische Fischarten. Der zweitgrößte Fluss Italiens hat im Laufe der Jahre jedoch dramatische Veränderungen durchgemacht.
Die Begradigung und Einengung des Flusslaufs, die Industrialisierung, und die damit einhergehende Umweltverschmutzung haben zu einem gravierenden Rückgang der Fischpopulationen geführt. Heute sind mehr als 60 Prozent der einst heimischen Fischarten entweder ausgestorben oder befinden sich in großer Gefahr.
Interview mit Dr. Alex Festi vom Fischereiverband Südtirol.
Welche Auswirkungen hatten die Begradigung und Einengung der Etsch sowie die Bonifizierungsmaßnahmen auf die Fischfauna?
Dr. Festi: Das große Artensterben in der Etsch begann vermutlich im Zuge der Bonifizierungsmaßnahmen in der Talsohle sowie der Begradigung und Einengung des Flusslaufs, wie wir ihn heute kennen. Dadurch gingen mehrere Habitattypen verloren, ebenso wie die damit verbundenen Fischarten. Typische kieslaichende Karpfenfische, wie der Pigo oder die Lau, sind infolgedessen verschwunden.
Wie bewerten Sie den Einfluss der Industrialisierung auf die Fischpopulationen der Etsch?
Die Industrialisierung hat die heimische Fischfauna auf zweifache Weise tiefgreifend verändert: durch den Bau von Wasserkraftwerken und durch die Errichtung großer Industrieanlagen. Zwischen den Weltkriegen wurde die Durchgängigkeit der Etsch durch Wehre bei Verona, Avio und Mori vollständig unterbrochen. Damit war es für Fische aus der Poebene oder dem Meer unmöglich geworden, die oberliegenden Gewässer zu erreichen. Ein markantes Beispiel dafür ist der Aal: Einst war er in allen Gräben und Seen des Etschtals unterhalb von Meran verbreitet und wurde regelmäßig gefischt – heute kommt er nur noch vereinzelt und ausschließlich dank Besatzmaßnahmen vor.
Auch in den Zuflüssen der Etsch kam es durch den Bau von Wasserkraftwerken mancherorts zur völligen Vernichtung der Fischfauna, insbesondere dort, wo Bäche komplett ausgeleitet wurden. Restwasser war bis in die 1980er Jahre kaum ein Thema. Hinzu kam die Belastung durch die aufkommende Schwerindustrie: Ab dem Ende des Ersten Weltkriegs führten ungeklärte Abwässer der großen Betriebe entlang der Etsch immer wieder zu wiederkehrendem, oft großflächigem Fischsterben. Dabei sind wohl auch einzelne Fischarten gänzlich verloren gegangen. Nicht zu unterschätzen ist zudem die Rolle der Landwirtschaft – vor allem in den kleineren Seitengewässern der Etsch. Bereits im 19. Jahrhundert berichteten Zeitungen regelmäßig von Fischsterben infolge von Spritzmitteleinleitungen, was wohl auch zum lokalen Aussterben gewisser Arten beigetragen hat.
Welche Maßnahmen könnten ergriffen werden, um die einheimischen Fischarten in der Etsch zu schützen und die Biodiversität wiederherzustellen?
Die wichtigste Maßnahme wäre zweifellos eine großflächige Renaturierung entlang der gesamten Etsch, um verlorene Lebensräume zurückzugewinnen. Derzeit ist dies jedoch utopisch, da es an geeigneten Flächen mangelt. Positiv hervorzuheben ist, dass die Wildbachverbauung in Südtirol keine Gelegenheit ungenutzt lässt, innerhalb der bestehenden Uferdämme ökomorphologische Verbesserungen umzusetzen. Auch kleinere Renaturierungen an Seitengewässern könnten einzelne Arten bereits wirkungsvoll unterstützen. Eine weitere entscheidende Maßnahme wäre die fischpassierbare Umgestaltung der Wehre bei Mori und Avio. Damit könnte der Lebensraum der Etsch zumindest zwischen Verona und Meran immerhin rund 155 Kilometer wieder miteinander verbunden werden. Davon würden insbesondere noch vorhandene heimische Arten wie die Marmorierte Forelle, die Adriaäsche oder die Padanische Barbe profitieren. Darüber hinaus wären gezielte Projekte zur Stützung oder Wiederansiedlung gefährdeter Arten in geeigneten Lebensräumen sinnvoll. In Südtirol ist hier bereits das Aquatische Artenschutzzentrum sehr aktiv und liefert wichtige Beiträge für den Schutz und die Wiederherstellung der Fischfauna.
Könnten Sie erläutern, welche Rolle gebietsfremde Arten in diesem Zusammenhang spielen und wie sie die einheimischen Fischarten beeinflussen?
Gebietsfremde Fischarten stellen für die heimische Fischfauna eine erhebliche Bedrohung dar – und das auf zwei Ebenen. Zum einen kann es zu Hybridisierungen kommen: Wenn sich eingeführte Arten mit einheimischen kreuzen, gehen genetische Eigenheiten verloren, die sich über Jahrtausende an die lokalen Bedingungen angepasst haben. Langfristig bedeutet das nicht nur den Verlust dieser Merkmale, sondern auch der gesamten Art. Das bekannteste Beispiel ist bei uns die Marmorierte Forelle, deren Bestand durch die Folgen der Kreuzungen mit der Bachforelle stark gefährdet ist. Zum anderen können gebietsfremde Arten durch Nahrungskonkurrenz oder direkte Prädation heimische Fische verdrängen oder sogar ausrotten. Ein prominentes Beispiel dafür ist der Wels, der in vielen Gewässern Italiens die heimische Fischfauna stark unter Druck gesetzt hat.
Wie können Akteure gemeinsam Biodiversitätsverlust bekämpfen und die Bevölkerung für den Artenschutz sensibilisieren?
Leider beobachten wir derzeit nur sehr wenig Kommunikation zwischen den politischen und administrativen Bereichen von Südtirol, Trentino und Veneto, wenn es um den Lebensraum Etsch geht. Wenn beispielsweise bei Verona an einer Fassung ein Fischpass gebaut wird, der exotischen Fischen erlaubt, auch flussaufwärts gelegene Abschnitte im Trentino zu besiedeln, entsteht ein ökologisches Problem. Oder wenn Südtirol nach dem neuesten Stand der Wissenschaft versucht, reine Marmorierte Forellen zu besetzen, andere Verwaltungen jedoch an längst überholten Konzepten festhalten, die der Art mehr schaden als nützen, haben wir ebenfalls ein Problem. Neben der Verwaltung muss auch die Bevölkerung kontinuierlich sensibilisiert werden. Es kann nicht sein, dass in öffentlichen Gewässern immer wieder Fische oder Krebse auftauchen, die von Aquarianern ausgesetzt wurden. Es muss klar kommuniziert werden: Solche Tiere gehören nicht in die freie Wildbahn und sollten nicht freigesetzt, sondern – wenn nötig – tiergerecht getötet werden.
Markus Auerbach