Pfrouslschtaud und Tschuferniggele

Bio und regional
18. September 2025
Meran und der Kampf gegen den Lärm
18. September 2025Drei Jahre lang waren sie unterwegs: zu Fuß, im Gespräch, bei Exkursionen. Über 100 Gewährspersonen haben sie befragt, alte Menschen, die Pflanzen nicht aus dem Biologiebuch kennen, sondern aus dem Leben.
von Josef Prantl
Mit seinem jüngsten Projekt hat Johannes Ortner gemeinsam mit der Biologin Angelika Ruele und dem Konservator für Botanik am Naturmuseum, Thomas Wilhalm, ein Werk geschaffen, das seinesgleichen sucht: eine Sammlung tausender mundartlicher Namen von über 500 Pflanzenarten in ganz Südtirol.
„Iss Kranewitt und Bibernell, noa påckt di do Tisl nit so schnell“ Wenn ich ehrlich bin, dann hat mich die Botanik in der Schule am wenigsten interessiert. Den „Zigori“ kenne ich und als Kind staunte ich immer über die Stadtler, die im Frühling bei uns auf den Wiesen Zigori gestochen haben. Dass die Vinschger zu den Blättern des Löwenzahns aber „Fåckapluam“ sagen, erstaunt mich. Der wissenschaftliche, lateinische Name lautet übrigens „Taraxacum“. Dann gibt es noch den deutschen Bücher- bzw. gemeinsprachlichen Namen, also „Löwenzahn“. Die vielen mundartlichen Bezeichnungen zum Löwenzahn sind allerdings nur wenigen bekannt. In Südtirol konnten 29 Namen für Blätter, Blüten und Fruchtstand gefunden werden. So heißt das Löwenzahnblatt in Terlan „Krotnkraut“ und am Ritten „Rearlkraut“. Umso mehr ist es Johannes Ortner zu danken, dass er mit seinem Werk tausende mundartliche Pflanzennamen vor dem Vergessen rettet. „Das „Gewöhnliche Leberblümchen“ – lateinisch Hepatica nobilis – wird zum Beispiel in Andrian (und z. T. noch in Nals und Vilpian) „Tschuferniggele“ genannt. „Volkstümliche Pflanzennamen gehören zum Dialekt und damit zum immateriellen Kulturerbe eines Gebietes“, sagt Ortner.

Der Dialekt verrät vieles
„Frognetlång“ heißt in Pflersch die Fuchs-Fingerwurz und es wurde ihr vom Volk aphrodisierende Wirkung zugeschrieben. Das Bestreben mundartliche Pflanzennamen in Südtirol zu bewahren, besteht schon lange. 1921 rief die Kulturzeitschrift „Der Schlern“ zur Sammlung von mundartlichen Tier- und Pflanzennamen auf. Die Reaktion war damals eher dürftig. Hundert Jahre später wurde nun dem Aufruf des „Schlern“ durch das Forschungsprojekt „Pfrouslschtaud und Tschuferniggele“ Folge geleistet. Koordiniert wurde das Projekt vom Fachbereich Botanik des Naturmuseums Südtirol, das sich neben der wissenschaftlich-botanischen Forschung auch einem kulturhistorischen Auftrag verpflichtet sieht.
Hüter der Namen
Johannes Ortner, 1973 in Meran geboren, ist ein lebendiges Wörterbuch unserer Heimat. Doch er sammelt nicht nur Namen, Begriffe, Bezeichnungen, er erzählt mit ihnen immer auch Geschichten. Seine Arbeiten zu den mundartlichen Pflanzennamen oder zu den Flurnamen sind weit mehr als bloße Dokumentation. Ortner hat in Wien Sozial- und Kulturanthropologie studiert, forschte über den Kalender der Hopi-Indianer in Arizona – und – was er an Theorie lernte, lebt er heute konsequent in seiner Heimat. Denn er weiß: Alte Pflanzen- und Flurnamen, über Jahrhunderte gewachsen, sind mehr als geografische Marker, als Bezeichnungen. Sie sprechen von Ackergrenzen, von Almwirtschaft, von religiösem Empfinden, vom Überleben, von den Wurzeln unserer Herkunft. Zwischen 1999 und 2013 hat Ortner maßgeblich an der „Flurnamensammlung Südtirol“ gearbeitet. Die Datenbank des Naturmuseums (www.flurnamen.natura.museum) umfasst inzwischen rund 175.000 deutsche, italienische und ladinische Bezeichnungen für Wiesen, Wälder, Berge, Höfe und Weiler.
Der Heimatpfleger
Doch Ortner ist kein Archivar im verstaubten Sinn. Als Obmann des Heimatschutzvereins Meran – des ältesten in ganz Tirol – vertritt er ein Heimatverständnis, das offen, kritisch und aktiv ist. Der 1908 gegründete Verein konnte bald seinen ersten Erfolg verbuchen, indem der Abriss des Vinschger Tors verhindert werden konnte. Bis heute setzt sich der Verein für die kleinen, oft übersehenen Schätze der Stadt und ihrer Umgebung ein: von der Baukultur über den Ensembleschutz bis hin zur Herausgabe von Publikationen. Auch im Meraner Gemeinderat ist Ortner aktiv, wo er mit derselben Sorgfalt wie in seinen Büchern und Filmen für den Schutz und die Pflege von Kulturgütern und Naturlandschaften eintritt. Ortners Arbeit ist eine seltene Synthese: wissenschaftlich präzise, aber nie trocken. Sein Südtiroler Pflanzennamenbuch – reich bebildert, durchzogen von Mundartgedichten, persönlichen Beobachtungen und Anekdoten – ist ein Gewinn für Botanikerinnen ebenso wie für Dialektliebhaber, für Heimatforscher, Lehrer und Studierende, für alle, die daran interessiert sind, wie wir geworden sind und was wir sind. Ortner stammt aus einer alten Meraner Familie, deren Vorfahren zu Beginn des 20. Jh. vor den Stadttoren eine Seifenfabrik gründeten (heute das Bistro „IM KULT“). Seine Eltern und sein Bruder führen heute in den Meraner Lauben das Traditionsgeschäft „Kikinger“.
Das Wissen der älteren Generation festhalten
Ein Porträt über Johannes Ortner ist immer auch ein Porträt über Südtirol – über das, was es einmal war, was es ist und was es werden kann: Solange es Menschen wie ihn gibt, die wissen, dass jedes Kraut, jedes Wort, jeder Name eine Bedeutung hat, die erzählt werden will.

Über die „Stinkmoidel“ und das „Fildrafaldra: Im Gespräch mit Johannes Ortner
Herr Ortner, was war für Sie der Auslöser, sich so intensiv mit mundartlichen Pflanzennamen zu beschäftigen?
Johannes Ortner: Die Initiative zum Schreiben dieses Buches ging von Thomas Wilhalm, dem Konservator für Botanik am Naturmuseum Südtirol, aus. Schon lange schwebte ihm eine flächendeckende Sammlung des mundartlichen Pflanzennamen-Wortschatzes nach wissenschaftlichen Kriterien vor. 2019 konnte ein Auftrag eingereicht werden, der aus Mitteln des Forschungsfonds der Südtiroler Landesmuseen finanziert wurde. Gemeinsam mit der engagierten Biologin Angelika Ruele konnte 2020 mit den Erhebungen vor Ort gestartet werden, nachdem alle verfügbare Literatur auf mundartliche Pflanzennamen „abgeklopft“ worden war. Mein persönlicher Zugang lässt sich an einem früheren Sommerjob festmachen: Zwischen 2001 und 2003 war ich drei Saisonen lang Betreuer im Naturpark Texelgruppe, wo ich – auf einer Bergwiese sitzend – die Alpenflora kennenlernen durfte, ein Privileg!
Gab es während der dreijährigen Forschungsarbeit eine Begegnung mit einer Gewährsperson, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
In der Tat, diese Begegnung gab es: ich erinnere mich gut an eine Bäuerin am Vinschger Sonnenberg, die einen langen Vormittag Kräuter in Wiese, Weide und Garten benannte.
Ins Gedächtnis brannte sich mir ihre Einteilung der Pflanzen in, so wörtlich, „Kräuter, die ich verehre“ und „Kräuter, die ich verfolge“. Erstere bezeichnen die der Gottesmutter geweihten Kräuter und Pflanzen wie Johanniskraut, Arnika, Thymian, Haselnuss usw., die einen Teil des „Kräuterbuschens“ bilden.
Mit zweiteren meinte sie freilich die Unkräuter, die man eben hartnäckig ausreißen muss. Dieser Spruch widerspiegelt sehr schön die „selektive“ Wahrnehmung des bäuerlichen Menschen.
Welcher Pflanzennamen hat Sie selbst am meisten überrascht – sei es wegen seiner Form, seiner Bedeutung oder der Geschichte dahinter?
In Martell konnten wir noch den Namen „Zielånt“ für das Kahle Steinrösl dokumentieren. Dieser Begriff ist bereits im 10. Jh. erwähnt („ziulinberi“) und ist der älteste dokumentierte Name dieser Pflanze. Weiters überraschten uns die Bezeichnungen „Fissikatori“ für den Scharfen Hahnenfuß in Schnals sowie die Matscher „Karschigglan“, für den Wiesen-Sauerampfer.
Diese Bezeichnungen kommen in den einschlägigen Mundartwörterbüchern nicht vor. Geradezu poetisch zärtlich sind Pflanzennamen wie „G’schamigs Kattele“ für das zart nach Zitrone duftende Moosauge. Dieses neigt seine Blüte schamhaft zum Waldboden und man muss sich tief blücken, um dem Kattele in die Augen zu schauen … Auch die „Fildrafaldra“ aus dem Brunecker Becken – es handelt sich um das Maiglöckchen – klingen wie ein melodischer Kinderreim, der einen betörenden Duft über taufrische Wiesen weht. Eine schöne Blüte hat auch die Mehl-Primel, diese riecht nur etwas „streng“, was ihr die Namen wie „Eselfårz“ oder „Stink-Moidel“ beschert hat …
Mundartliche Pflanzennamen sind ja nicht nur Sprache, sondern auch Kulturgeschichte. Was verraten sie uns über das Leben früherer Generationen in Südtirol?
Pflanzen dienten nicht nur der Schönheit, indem sie z. B. als Schmuckblume unsere „Solder“ und „Fensterwålken“ verschönern, sondern sie dienten häufig auch als Medizinalpflanzen. Ohne „Viechdoktor“ musste man sich selbst zu helfen wissen. Litten Weidetiere an Durchfall, wurde ihnen in Villanders „Hoberrautmilch“ eingeflößt, ein in Milch eingelegter Absud der Moschus-Schafgarbe. Mit „Muaterkrautschnaps“ (beim Muaterkraut handelt es sich immer um die Moschus-Schafgarbe) kurierte man in Schnals eine Magenverstimmung. Solche und ähnliche Anwendungen konnten uns viele Gewährspersonen aus eigener Erfahrung schildern.
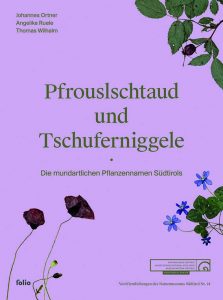
Sie haben bereits an der großen Flurnamensammlung mitgearbeitet. Wo sehen Sie die Parallelen zwischen Flurnamen und Pflanzennamen?
Von der Methodik sind sich beide Sammlungen ähnlich. Denn mittels Feldforschung wird das Wissen der älteren Generation festgehalten. Die mundartliche Transkription des Pflanzennamens oder Flurnamens soll dem Gesprochenen so nah wie möglich kommen. Statt der Lokalisierung eines Flurnamens im Gelände muss bei der Identifizierung eines angesprochenen Wald- oder Wiesengrases eine Fachperson, ein Botaniker mithelfen.
Als Obmann des Heimatschutzvereins Meran vertreten Sie ein „offenes, kritisches Heimatverständnis“. Wie passt das mit Ihrer Arbeit an so tief verwurzelten, traditionellen Themen zusammen?
Wenn man sich mit einem „verwurzelten“ Thema wie Kräuter oder Flurnamen befasst, dann öffnet dies Tore zu anderen Kulturen, auch außeralpinen und außereuropäischen.
Das ökologische Gleichgewicht, das durch die traditionelle Bewirtschaftung unserer Almen und Bergwiesen in Jahrtausenden entstanden ist und worauf sich eine angepasste, sensible Pflanzenwelt etablieren konnte, kann durch Profitmaximierung („Gülleausbringung“) von einem Tag auf den anderen unwiederbringlich zerstört werden. Das Interesse an ökologischer Nachhaltigkeit wird auch den Kleinbauern in Zentralafrika umtreiben oder die indigene Kräutersammlerin im Amazonasbecken beschäftigen. Pflanzenwissen und Flurnamen als „dichte Beschreibung eines Fleckens Erde“ – eine Universalie?
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten: Was sollte mit Ihrem Projekt „Pfrouslschtaud und Tschuferniggele“ in Zukunft passieren – als Buch, als Datenbank, als Teil des kulturellen Gedächtnisses Südtirols?
Uns freut es außerordentlich, dass das Buch schon nach einem Jahr als 2. überarbeitete Auflage erschienen ist. Keine Selbstverständlichkeit angesichts des doch speziellen Themas. Die Pflanzennamen Südtirols sollten zukünftig die Datenbank und Webseite „Flora Fauna Südtirol“ ergänzen, indem die Mundartbezeichnungen den deutschen und italienischen Büchernamen sowie den wissenschaftlichen Namen zur Seite gestellt werden. Das Buch wurde durch das finanzielle Engagement einer Stiftung unter Vermittlung der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft an Südtirols Schulen verteilt, in der Hoffnung das Interesse der Schülerinnen und Schüler an Dialekt und Botanik zu wecken.


